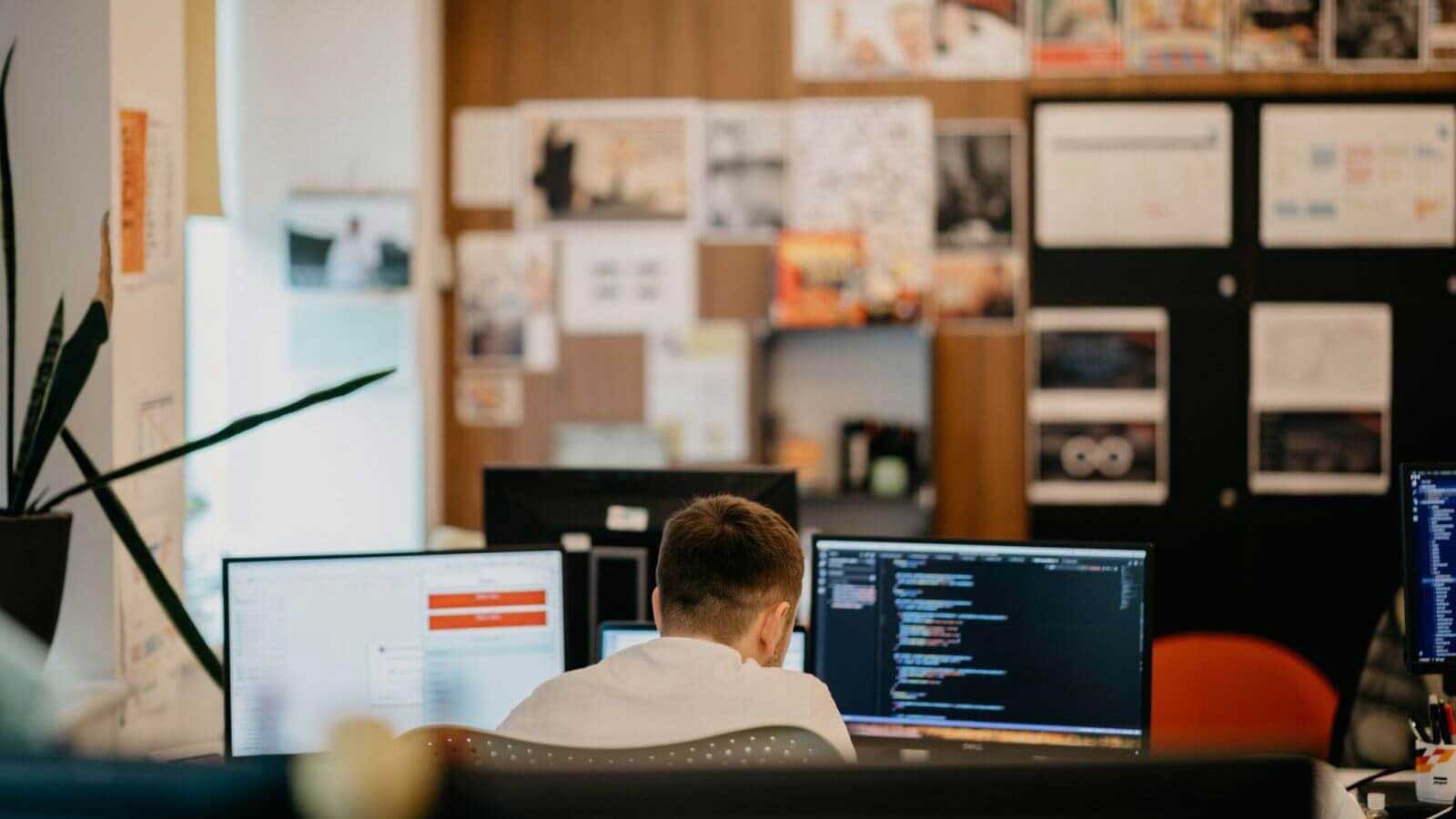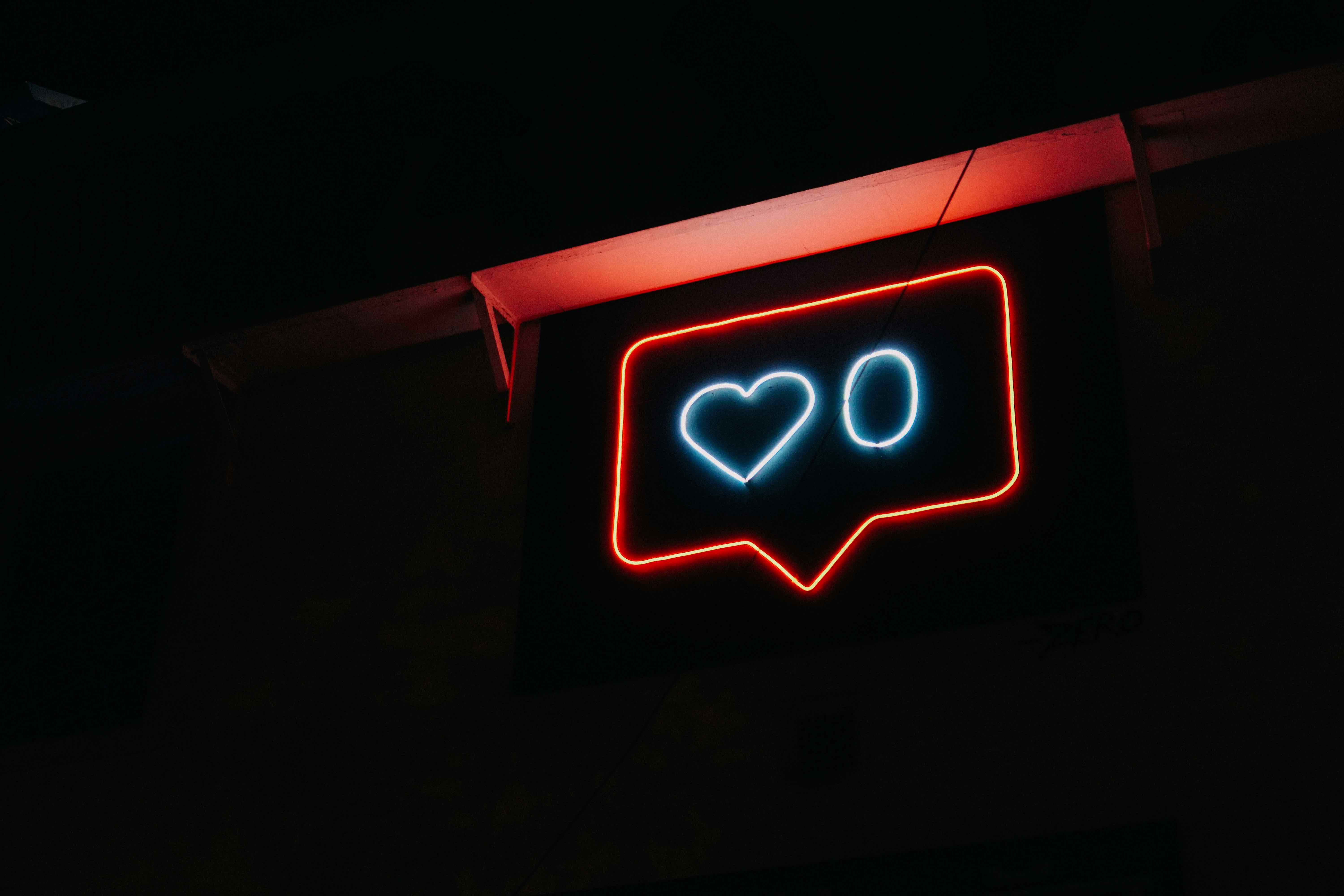Im Online Marketing ist alles messbar, die Zeiten des Wanamaker’schen Bonmots, wonach 50% des Marketing-Gelds verschwendet seien, sind angeblich vorbei. Doch diese Messbarkeit führt oft zu einem Backlash: Statt Online Marketing auf strategische Unternehmensziele abzustimmen, setzt man es rein taktisch ein: als blossen Performance-Kanal. Das Resultat ist schlechtes Marketing.
«How Google Analytics ruined marketing», lautete der Titel eines kürzlich in Techcrunch publizierten Artikels von Samuel Scott. Seine zentrale These zielt frontal gegen das Heilsversprechen des Online Marketings: Tools wie Google Analytics, so Scott, würden zu einer rein ROI-basierten Betrachtungsweise jeglichen Online Marketings führen und somit zu einem verengten Blick.
Aus entgegengesetzter Richtung, aber auf den gleichen Punkt abzielend, donnerte wenig später eine hochamüsante Polemik Christian Meyers daher, seines Zeichens Media- und Digitalverantwortlicher bei der Theo Müller Gruppe («Müllermilch»): Angewidert von Buzz Words und Schaumschlägerei der digitalen Branche vermeldet er seine Südseeferienabwesenheit ausgerechnet während der dmexco und verprügelt sämtliche digitalen Marketingheilsversprechen in einem grossen Rundumschlag. Zwischendurch stellt Meyer eine provokative, in vielerlei Hinsicht die Misere exakt umreissende Frage:
«Frag’ doch mal die Agentur oder den Vermarkter, ob sie sich am Erfolg messen lassen möchten. Sehr erhellend. Sich mit dem Kunden das Risiko bei Dienstleistungen und Produkten, deren Wirkungsnachweis häufig noch zu erbringen ist, teilen? Och nöööö du.»
Christian Meyer, Theo Müller Gruppe
Nö du. Das wollen wir tatsächlich nicht. Aber keineswegs aus den Gründen, die Meyer unterstellt («Der Glaube ans eigene Produkt gone with the wind»). Erhellend ist nämlich weniger die Antwort der Agenturen und Vermarkter:innen als vielmehr die Frage selber, die auf ein ganz bestimmtes Mindset gerade auch der Werbeauftraggeber:innen verweist: das verengte Performance Mindset, das im harmlosesten Fall zu Blödsinn wie erfolgsbasierten Honoraren, im schlimmsten Fall zu schlechtem Marketing führt.
Was heisst Erfolg?
Erstens: Die Wirkung von Marketing-Massnahmen ist immer interdependent, der Agentureinfluss zumeist aber nur punktuell gegeben. Beispiel: Fahren unsere Kund:innen TV-Kampagnen, schiessen unsere Google Ads-Zahlen durch die Decke. Das ist zwar schön, aber ich würde mich hüten, dafür ein Erfolgshonorar abzukassieren. Wenn umgekehrt (apropos Müllermilch) ein Unternehmen seine Produkte bescheuert verpackt und schlechte PR kriegt, kann die Online-Agentur für absackende Performance ja nix. Bestraft wird sie trotzdem.
Zweitens – und das ist mein Haupteinwand – ist die Fixierung auf messbaren Erfolg in vielerlei Hinsicht eine strategische Katastrophe: Wenn man Erfolg auf direkt und sofort messbare Effekte reduziert, verkommt Online Marketing zur Taktik ohne Strategiebezug.
Pepsi: 80 Millionen Votes, 5% weniger Marktanteil
Ein Musterbeispiel für eine verunglückte Fokussierung auf Messbares lieferte das «Refresh Project» von Pepsi im Jahr 2010. Getreu dem Cluetrain Manifesto («Märkte sind Gespräche») sowie der Erkenntnis folgend, die Welt sei neuerdings digital, schichtete Pepsi 2010 massive Werbebudgets um, verzichtete unter anderem auf Super Bowl Ads und lancierte lärmend eine Plattform, auf der Grants für tolle Ideen vergeben wurden. Die Idee dahinter: Das gibt Gespräche und somit einen Markt. Resultat: 80 Millionen Votes, 3.5 Millionen Likes, 60‘000 Twitter Follower. Engagement, das sich sehen liess, und so ziemlich jede:r Social Media Consultant malte begeistert Slides.
Trotzdem war es eines der grössten Marketing-Debakel der jüngeren Geschichte: Pepsi büsste 2010 satte 5% Marktanteil ein und fiel hinter Diet Coke auf Platz 3 der beliebtesten Soft Drinks der USA zurück. Der Einsatz von Massenmedien, in der Wirkung schwer messbar, wurde also ersetzt mit präzis quantifizierbaren Massnahmen in sozialen Medien. Die Interdependenz wurde ignoriert, der Echoraum war offenbar doch zu klein und nach nur zwei Jahren wurde das Projekt stillschweigend beerdigt. Seither wirbt Pepsi wieder beim Super Bowl.
Performance ist ein Ausnahmefall
Innerhalb des Ökosystems Online Marketing selber zieht sich der oben beschriebene Verengungsmechanismus oft fort: Gutes Online Marketing ist auf einmal nur noch jenes, dem Google Analytics unmittelbar oder via Attribution Umsatz zuweist. «Messbar» verengt sich zu «konvertierend», «Erfolg» wird zu «Umsatz». Damit aber entfernt sich Marketing von seinen Rezipient:innen: den potenziellen Kund:innen. Die kaufen nämlich keineswegs pausenlos ein, sondern bloss ausnahmsweise. Ausgerechnet an jenem Ausnahmefall orientiert sich aber, wer in der Performance-Falle steckt. Messbarkeit ist hier kein Charakteristikum mehr, sondern wird als Erfolgsvoraussetzung missverstanden.
Das entbehrt jeglicher Logik und führt zu Marktferne: Angenommen, ein anständig funktionierender Online Shop generiert auf sämtlichen bezahlten Werbemassnahmen eine Konversionsrate von 5%, so wäre aus Performance-Optik das retrospektive Ziel also gewesen, das Budget ausschliesslich auf exakt jene 5% verwendet zu haben. Alles andere gilt als Streuverlust und Misserfolg. Also wird man den Streuverlust minimieren, und zwar mit dem erklärten Ziel, künftig den allergrössten Teil seines Publikums zu ignorieren.
Marketing wirkt selten jetzt
Von dieser Logikferne zeugen immer wieder auch jene Werbebanner, die mir völlig unvermittelt befehlen: «Jetzt kaufen!». Kürzlich etwa fand ein Werbetreibender rätselhafterweise, ich müsse jetzt sofort einen Feldstecher bestellen. Nichts lag mir zu diesem Zeitpunkt ferner, und nein, es handelte sich keineswegs um eine Remarketing-Einblendung. Das verärgerte mich derart (zugegeben, das Werbemittel war ein Interstitial auf meinem Handy, was sowieso das Letzte ist), dass ich bei dieser Firma auf Jahre hinaus nichts kaufen werde.
Der Gegenentwurf: Man hätte mich ja mal sanft umwerben können; mir das Unternehmen charmant vor Augen führen und später aufzeigen, wie schön die Welt dank diesem fabelhaften Feldstecher aussieht. Nach und nach hätte man mich – dank spannendem Content und mit Methoden des sequentiellen Remarketings – vielleicht zum Kauf bewegen können. Aber nein, Online Marketing ist messbar, also soll der renitente Kerl diesen Feldstecher jetzt kaufen, schliesslich muss jetzt ROI her. Funktioniert die Kampagne nicht, so ist entweder Banner-Werbung im allgemeinen Mist oder aber die Agentur im Speziellen. Kein Wunder, lehnt sie ein Erfolgshonorar ab, QED.
Gute Werbung muss nicht verkaufen
Wohlgemerkt: Gegen reine Performance-Strategien ist überhaupt nichts einzuwenden. Viele Unternehmen fahren gut damit, limitieren sich dabei zwar im Wachstum, was aber bekanntlich auch seine angenehmen Seiten hat. Problematisch wird es erst, wenn es sich nicht um eine Strategie handelt, sondern um eine Taktik («Traffic mit möglichst hohem ROI einkaufen»), die den strategischen Unternehmenszielen («Wachstum») diametral entgegensteht. Das zu übersehen fällt leider leicht: Da Internet Audience und-Tätigkeit weiter zunehmen, scheint Performance Marketing Wachstum zu generieren. Doch das ist ein Trugbild: Man bewegt sich oft bloss im Gleichschritt mit einem Wachstum, das ohnehin stattfindet. Das böse Erwachen kommt erst, wenn Sättigungseffekte greifen und Konkurrenten, die sich zuvor eingehender um die 95% Nichtkonvertierenden bemüht haben, Marktanteile gewinnen.
Der User nämlich wird gut gemachte Werbung, die ihm noch gar nichts verkaufen will, durchaus honorieren und sie wird seine Geneigtheit, dereinst diesen Feldstecher zu kaufen, durchaus beeinflussen. Entgegen der Performance-Denke ist es nämlich äusserst sinnvoll, Geld für Massnahmen auszugeben, die keinerlei Umsatz bringen.
Procter & Gambles wunderbare Clips «Always like a girl» etwa enthalten sich jeder kommerziellen Message und sind indirekt höchst erfolgreich: Die Google Queries beispielsweise nach «always pads» sind seit jener Kampagne von Leo Burnett hochgeschossen. «Na eben», mag Christian Meyer da einwerfen, «Erfolg lässt sich doch messen.» Gewiss. Aber nur mit den korrekten Kennzahlen. In diesem Fall hier ging es um einen Brand Lift.
Erfolg muss von den Konsument:innen her definiert werden
Das Problem, das sich also stellt, ist dies: Je nach Massnahme, je nach eingesetztem Kanal, je nach Zielsetzung muss Erfolg anders definiert werden. Oder anders und revolutionärerweise mal ganz aus Konsument:innensicht formuliert: Je nach User und seinem aktuellen Verhältnis zum werbenden Unternehmen bedeutet Erfolg etwas anderes. (Viel Glück übrigens dabei, sowas in ein Performance-Modell für die Agentur zu packen.)
Performance stellt bei dieser Betrachtungsweise bloss eine einzige von vielen Ausprägungen dar, mehr nicht. Wer aber seine Agentur auf Performance incentiviert, macht sie zum taktischen Handlanger statt zum strategischen Partner und beklagt anschliessend die mangelhafte Beratungsleistung. So wie Christian Meyer:
«So lange wir nicht beginnen, uns wieder auf das Wesentliche zu konzentrieren, wir weiterhin – häufig unreflektiert – dem digitalen Wahn verfallen, Agenturen ihrem Beratungsauftrag immer seltener gerecht werden (…) solange wird sich nichts ändern.»
C. Meyer
Gewiss: Agenturen fordern ihre Kund:innen zu selten heraus. Unter anderem deshalb, weil Unternehmen diese Herausforderung zu selten annehmen. Um aus der Performance-Falle rauszuklettern, braucht es aber eine Zusammenarbeit. Was Meyer übersieht oder verschweigt: Tatsächlich handelt es sich hier um eine unheilige Allianz von Wunschdenkenden sowohl auf Auftraggeber:innen- als auch auf Agenturenseite. Da der Kram ja messbar ist, wollen die Auftraggeber:innen Erfolg einkaufen, weshalb ihnen der Markt bereitwillig Erfolg verspricht. Da der Erfolgsbegriff aber selten scharf definiert wird, sind am Ende alle enttäuscht und zeigen reihum aufeinander.
Meyer schreibt denn auch vollkommen zutreffend:
«Digital is everything? No, it’s not. Gute Kommunikation is everything for every thing! Und die beginnt bitte schön immer noch mit einer guten Idee, gefolgt von einer guten Kreation und endet mit einem guten Mediaplan. Daran hat sich auch im digitalen Zeitalter nichts geändert.»
C. Meyer
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Mehr Artikel?
Alle Artikel ansehenFragen?
Partner